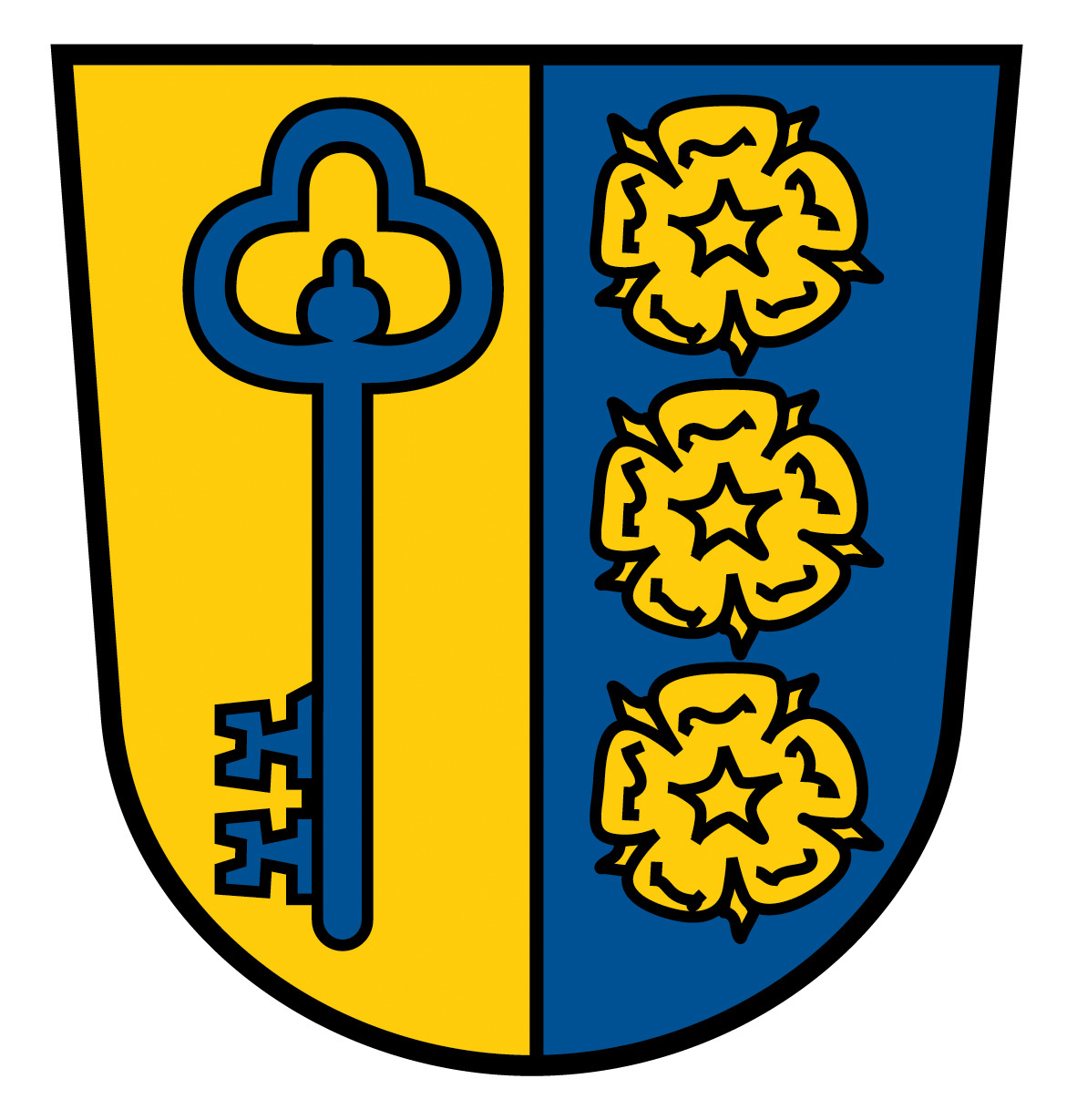Unser Wasser
Seit dem 24. Dezember 1996 ist der neue Brunnen ans Ortsnetz angeschlossen. Alle Messwerte des Wasser befinden sich im grünen Bereich, d.h. das Wasser kann uneingeschränkt von allen für alles benutzt werden. Die Kontrollen für die Wasserqualität werden jährlich von einem unabhängigen Institut durchgeführt.
Greußenheim übernimmt eine Vorreiterrolle: es wurde viel Geld in umweltpolitische Belange investiert. Die Eigenwasserversorgung hat ein vorbildliches Wasserschutzgebiet, und viele andere Projekte der Gemeinde sind vorbildlich in ihrer Umweltfreundlichkeit und ihrem Energienutzwert. Doch die eigene Wasserversorgung stellt einen besonderen Punkt in Greußenheims Geschichte da.
1927 wurde die Wasserversorgung der Gemeinde erstellt. Schon 1949 war das Trinkwasser nicht mehr in Ordnung. Das Gesundheitsamt hatte immer wieder starke Bedenken wegen der Qualität des Wasser geäußert und forderte die Gemeinde wiederholt, auf einen neuen Brunnen zu bohren und ein neues Wasserschutzgebiet auszuweisen. Jedoch erst gut 50 Jahre später reagierte man in Greußenheim.
Der 1927/1928 erschlossene "Süße Brunnen", der unter schwierigen Bedingungen gebohrt wurde, wies in den 50er Jahren erhebliche Belastungen durch Mikroorganismen auf. 1954 wurden zu viele Kolibakterien festgestellt. Das Wasser durfte erst mal nur noch abgekocht genossen werden. Über 30 Jahre lang wurde dann das Wasser sehr aufwändig chemisch aufbereitet.
Anfang der 90er Jahre entschloss man sich dann endgültig, dass Wasserproblem anzugehen. Aufgrund seiner Nähe zum Dorf musste der Brunnen in ein anderes Gebiet abgeteuft werden, um dort eine ausreichende Schutzzone auszuweisen. Durch verschiedene Bohrungen und Probepumpungen wurde dann im Anströmbereich das neue Brunnengebiet festgelegt. Das Wasser in diesem Gebiet war qualitativ einwandfrei, bis auf eine leichte Überschreitung der Nitratwerte.
Der zu hohe Nitratwert konnte dank einer guten Zusammenarbeit der Gemeinde mit betroffenen Landwirten in der neuen Umgebung des Brunnens schnell gelöst werden. Es wurde eine Flächenstilllegung mit Grünbrache veranlasst. Zur Unterstützung wurden verschiedene Förderprogramme genutzt. Insgesamt wurden 70ha landwirtschaftliche Fläche, das sind 10 % der gesamten Greußenheimer landwirtschaftlich genutzten Böden, in Grünflächen umgewandelt, und zum Teil mit Obstbäumen bepflanzt. Der Nitratgehalt vom Trinkwasser reduzierte sich dabei von ca. 65 mgr. auf ca. 36 mgr. Nitrat.
Das Urteil der Fachbehörden: vorbildlich und modellhaft für ganz Unterfranken!
Wasserschutzgebiet
Die Firma Benkert bepflanzt im Rahmen eines ökologischen Ausgleiches 2 ha Fläche im Wasserschutzgebiet mit Waldbäumen.
Die Gemeinde Greußenheim hat der Firma Benkert, Thüngersheim-Roßbrunn, eine Fläche von rd. 2 ha im Wasserschutzgebiet zur Aufforstung verpachtet. Die Aufforstung durch und auf Kosten der Firma Benkert findet als ökologische Ausgleichsmaßnahme für eine Erweiterung des Betriebes statt.
Die Aufforstung hat für die Gemeinde Greußenheim große Vorteile:
- Das notwendige Mähen und Mulchen der Fläche entfällt.
- Es muss kein Ausgleich an Bewirtschafter wegen Nichtbewirtschaftung gezahlt werden.
- Es entsteht ein neues Rückzugsgebiet für die Tierwelt.
- Der neue Wald dient dem Klimaschutz 5.
- Der neue Wald kann eine optische Abgrenzung zur geplanten Trasse der B 26n bilden.
- Der neue Wald ist Eigentum der Gemeinde Greußenheim.